Abschlussarbeit von Paul Endres, als PDF lesen
Die Gestaltung von Schranken
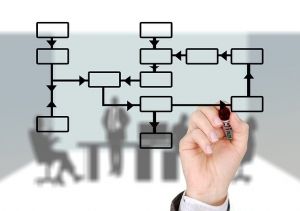 Wie Menschen sich selbst ihre Umwelten schaffen
Wie Menschen sich selbst ihre Umwelten schaffen
1967 stellte Harold Garfinkel, Professor für Soziologie an der University of California, seinen Studenten eine Aufgabe, mit der er ein Phänomen zwischenmenschlicher Verhaltensweisen untersuchen wollte, das Karl Weick einige Jahre später zu der Vermutung veranlassen sollten, dass
Manager oft viel weniger über ihre Umwelten und Organisationen wissen, als sie annehmen.
(Weick, 1985, S. 218)
Die Studenten bekamen den Auftrag, in Kaufhäuser zu gehen und dort mit dem Verkäufer eine Verhandlung über den ausgeschriebenen Warenpreis zu beginnen.
Schon damals war es in Großhandlungen unüblich, über den Preis eines Artikels zu feilschen, es galt das unausgesprochene Gesetz der Listenpreise, das den Waren Festpreise zuschrieb und von den meisten Käufern anstandslos akzeptiert wurde.
Was für die Studenten als eine Überwindung zum Konventionsbruch begann, entpuppte sich als ein Experiment mit überraschendem Ergebnis:
obwohl sich viele Verkäufer erstaunt zeigten, konnte doch in vielen Fällen ein Rabatt ausgehandelt und der Artikel zu einem günstigeren Preis erworben werden.
Die Listenpreisregel schien nur deshalb in Kraft zu sein, weil jedermann erwartete, dass sie befolgt wird und niemand sie infrage stellte.
Damit bestätigte sich Garfinkels Vermutung, die ihn zu seinem Experiment veranlasst hatte: auf Grundlage von vermiedenen Tests (in diesem Fall der Versuch, einen Preisnachlass auszuhandeln), gestalten sich Menschen häufig Umwelten, die ihr Handeln erheblich einschränken.
Garfinkel beobachtete, dass Menschen ihre Untätigkeit häufig dadurch rechtfertigen, dass sie in ihrer Fantasie Zwänge und Schranken aufbauen, die ihr Handeln verhindern.
Diese Zwänge und Schranken werden dann zu bedeutsamen „Dingen“ in der Umwelt
(Weick, 1985, S. 215)
und begrenzen als selbstauferlegte Einschränkungen der Wahlmöglichkeiten menschliche Verhaltensweisen.
Zudem schien dieser Effekt durch eine pluralistische Ignoranz zunehmend verstärkt zu werden: indem Personen sich gegenseitig beim Vermeiden von bestimmten Vorgehensweisen beobachteten, schlossen sie offenbar daraus, dass diese Vorsicht durch „reale“ Gefahren in der Umwelt begründet sei und vermieden diese Handlungen und ihre mutmaßliche Konsequenzen selbst.
Letztendlich glaubten alle mehr über etwas zu wissen, das keiner von ihnen unmittelbar erfahren hatte.
(Vgl. Garfinkel, 1962)
Gestalten als Kennzeichen des Organisierens
Diese Entdeckung Garfinkels, veranlassten Karl Weick zu der Überlegung, dass auch die Substanz interdependenter Organisationen zu einem großen Teil aus „unechtem, auf vermiedenen Tests beruhendem Wissen“ bestehen könnte.
So vermutete er, dass Mitglieder von Organisationen oft viel weniger über ihre unmittelbare Umwelt wissen, als sie es glauben, „da sie unbewusst und insgeheim miteinander übereingekommen sind, Tests zu vermeiden“ (Weick, 1985, S. 218).
Das würde bedeuteten, dass Organisationen ihre Umwelt nicht objektiv wahrnehmen und dabei kausal auf empirische Inputs reagieren, sondern (oft unbewusst) selbst entscheiden, mit welchem Weltbild sie ihre Organisation konfrontieren.
Mit dieser Idee regt Weick nicht nur an, standardisierte Organisationsabläufe zu überdenken, sondern liefert auch den Anlass, die Definition des Organisationsbegriffs um ein wesentliches Kennzeichen zu erweitern.
Seinem Verständnis nach kennzeichnet sich das Organisieren vor allem durch einen konstruktivistischen Prozess sozialer Konsensbildung, in dem sich die Organisationsmitglieder darüber einigen, was Illusion und was Wirklichkeit ist.
Damit ist für Weick der Vorgang des Gestaltens, eines der wichtigsten Attribute des Organisierens.
Erst durch einen kollektiven schöpferischen Akt sind Organisationen seiner Meinung nach überhaupt in der Lage, Umwelteindrücke zu verarbeiten und in verwertbare Informationen umzuwandeln.
Doch wie ist diese besondere Definition Weicks zu verstehen?
Welche Implikationen ergeben sich für das Verständnis des Organisierens aus diesem konstruktivistischen Blickwinkel?
Welche Vorteile bieten sich einer Organisation, die sich ihre eigene Umwelt erschafft?
Und welche Gefahren lauern hinter scheinbar reibungslosen Problemlösungsmethoden, über die Organisationen ihr Weltbild definieren?
Diesen Fragen soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden, indem das weicksche Verständnis eines gestaltenden Organisierens genauer erläutert, und anhand von Beispielen veranschaulicht werden soll.
Außerdem sollen Potentiale und Möglichkeiten aufgezeigt werden, die sich für Organisationen ergeben, die sich ihrer gestaltenden Funktion bewusst sind, während gleichzeitig die Gefahren und Risiken untersucht werden, die solchen Organisationen drohen, die dieses besondere Kennzeichen ihrer Tätigkeit ignorieren.
In einer abschließenden Betrachtung sollen zuletzt die Ergebnisse dieser Analyse in einer persönlichen Stellungnahme reflektiert und in praktischen Bezug zur alltäglichen Arbeitswelt einer Organisation gesetzt werden.
Grundzüge der Organisationstheorie Karl Weicks
Um näher auf die Rolle des Gestaltens im Kontext des Organisierens eingehen zu können, soll hier zunächst eine kurze Einführung in die Organisationstheorie im Sinne Karl Weicks gegeben werden.
Dieser definiert den Prozess des Organisierens als
durch Konsens gültig gemachte Grammatik für die Reduktion von Mehrdeutigkeit, mittels bewusst ineinander greifender Handlungen
(Weick, 1985, S. 11)
Er beschreibt damit einen gemeinschaftlichen Vorgang, in dem eine Vielzahl von Menschen mithilfe tradierter sozialer Mechanismen versuchen, die Komplexität eines mehrdeutigen Inputs so weit zu reduzieren, dass auf der Basis eines allgemeinen Konsens gemeinsam gearbeitet werden kann.
Das Ziel jedes Organisierens ist also ein „tragfähiges Sicherheitsniveau“, (Weick, 1985, S. 15) auf dessen Grundlage der Aufbau komplexer arbeitsteiliger Prozesse möglich wird.
Ausgelöst werden solche sozialen Prozesse nach Karl Weick immer durch einen „Mehrdeutigen Input“ (Weick, 1985, S. 12), also ein Vorkommnis, das einen Unterschied, eine Diskontinuität gegenüber bisherigem bedeutet.
Solange nämlich alles reibungslos abläuft, muss die Organisation sich nicht um Sinngebung bemühen, da jede Eingangsgröße wie gewohnt mittels Programmen und Kommunikationsstrukturen verarbeitet werden kann.
Erst eine Abweichung von der vorhergedeuteten Wirklichkeit (die hier später als „ökologischer Wandel“ bezeichnet werden soll), setzt gemeinsame Versuche der Sinngebung in Gang und stellt damit den Anlass des Organisierens dar.
Ist die Organisation dann auf solch einen mehrdeutigen Input aufmerksam geworden, wird ein Prozess in Gang gesetzt, dessen Grundbausteine Karl Weick als „Doppelte Interakte“ bezeichnet.
Damit beschreibt er ineinandergreifende Verhaltensweisen, von mehreren Personen, die untereinander zirkulär verbunden sind.
Die Erwartung, wie eine andere Person auf das eigene Verhalten reagiert, wird damit in die Verhaltensabsichten mit einbezogen, sodass wechselseitige Abhängigkeiten entstehen. Mithilfe „systematischer Zusammenstellungen von Regeln und Konventionen“ (auch: „Ursachenkarten“), (Weick, 1985, S. ebd.) werden diese zirkulären Folgen ineinandergreifender Verhaltensweisen dann so zusammengefügt, dass sie verständliche soziale Prozesse bilden.
Diese Regeln und Konventionen, die soziale Prozesse methodisch gliedern, können auch als Rezepte verstanden werden, „(…) die beschreiben, wie Dinge getan werden sollen, die eine Person alleine nicht tun kann, bzw. wie das, was getan wurde Interpretiert werden soll.“ (Weick, 1985, S. ebd.)
Nach dieser reichlich abstrakten Einleitung soll im Folgenden genauer beschrieben werden, in welche einzelnen Schritte Karl Weick diesen Prozess des Organisierens aufgliedert und welche Rolle dabei das Konzept des evolutionären Wandels spielt, um später genauer auf die Bedeutung der Gestaltung innerhalb des Organisierens eingehen zu können.
Organisation als natürliche Auslese
Um zu verstehen warum Karl Weick den Prozess des Organisierens mit dem Konzept der natürlichen Auslese in Verbindung bringt, müssen zunächst einmal einige kennzeichnende Eigenschaften der darwinistischen Evolutionstheorie erläutert werden.
- Variationen sind immer zufällig.
Die Evolution folgt damit keinem Plan oder sonst einer ordnenden Außenanleitung. - Damit gilt, dass alle erscheinenden Ordnungsmuster den selektiven Selbstorganisationsmechanismen zu verdanken sind, indem besonders adaptive Variationen ausgelesen werden.
- Evolutionäre Ordnungsbildung kann deshalb niemals vorausschauend stattfinden, sondern immer erst rückblickend erkannt werden. (Vgl. Weick, 1985, S. 179)
Dass diese charakteristischen Merkmale auch für den Prozess des Organisierens Gültigkeit haben, soll im Folgenden aufgezeigt werden, indem die einzelnen Elemente der natürlichen Auslese (Variation, Selektion und Retention) mit organisatorischen Vorgängen in Verbindung gebracht werden.









